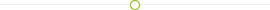Werte tragen Unternehmen in die Zukunft
27. Oktober 2025
Für welche Werte entscheide ich mich auf meinem Weg?
28. Oktober 2025Katharina Moser ist Moderatorin, Experience Designerin
und Teil des globalen Führungsteams der Inner Development Goals. Sie kuratiert, gestaltet und moderiert den jährlichen IDG Summit und setzt auf die Kraft authentischer Begegnungen als Motor für Wandel. Zuvor arbeitete sie für das Außenministerium, das British Council und das Europäische Forum Alpbach.
Mit ihrer Agentur MOSAIK realisierte sie vielfach ausgezeichnete Europa-Projekte.
www.katharinamoser.eu

Die Österreicherin Katharina Moser ist Mitglied des Executive Boards der Inner Development Goals. Wir sprechen mit ihr über Werte und Wirkung dieser Initiative in einer zunehmend komplexen Welt; über Verantwortung, Widerstände und die Kunst, die
Herausforderungen unserer Zeit in Hoffnung zu wandeln.
Die Inner Development Goals (IDGs) sind ein populär gewordenes Framework für innere Entwicklung – ein Set an Fähigkeiten, die es braucht, um als Individuum, Organisation oder Gesellschaft in einer immer komplexeren Welt handlungsfähig zu bleiben.
Sie umfassen 23 Kompetenzen, gegliedert in fünf Dimensionen („Being“,
„Thinking“, „Relating“, „Collaborating“, „Acting“): Von Selbsterkenntnis und Komplexitätsbewusstsein über Empathie bis hin zu Mut oder Kreativität.
Entstanden sind sie aus einer Einsicht: Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die Sustainable Development Goals (SDGs), lassen sich nicht allein durch technologische oder politische Maßnahmen verwirklichen. Sie erfordern einen tiefgreifenden kulturellen Wandel – und der beginnt bei der inneren Entwicklung des Einzelnen.
Thema Zukunft (TZ): Katharina, die IDGs befassen sich mit dem, was Menschen innerlich stärkt. Woran fehlt es uns heute am meisten?
Katharina Moser (KM): Vielleicht am tiefen Gefühl der Verbundenheit – mit uns selbst, mit anderen und mit dem Planeten. Vieles von dem, womit wir uns als Gesellschaften herumschlagen, hat mit Entfremdung zu tun. Wir erleben uns getrennt von der Natur, voneinander und oft genug auch von uns selbst. So gut wie alle unserer globalen Herausforderungen lassen sich auf die eine oder andere Form dieser Unverbundenheit zurückführen. Die IDGs setzen hier an: Sie bieten einen strukturierten Zugang zu Kompetenzen, die unsere Resilienz und Handlungsfähigkeit stärken, mit den Herausforderungen unserer Zeit umzugehen.
TZ: Die IDGs verstehen sich als Framework und sind als solches rasch global bekannt geworden. Was macht sie so anschlussfähig?
KM: Sie sind keine neue Theorie, sondern eher eine Art gemeinsame Sprache. Viele Wissenschafter:innen, Organisationen, Religionen beschäftigen sich seit ewig mit vielen Aspekten von Persönlichkeitsentwicklung - wie auch mit Wandel. Das ist alles nichts Neues. Die IDGs helfen als eine Art „Added Layer“ dabei, bestehende Aktivitäten einzuordnen, Brücken zu bauen und Fehlendes aufzuzeigen. Sie schlagen eine gemeinsame Ordnung vor, die sich wiederum in unterschiedlichste Kontexte integrieren lässt.
TZ: Manche sehen Persönlichkeitsentwicklung vor allem als privates Engagement. Warum sollte dies also ein strategisches Thema für Unternehmen und Organisationen sein?
KM: Weil Kultur von innen nach außen wirkt. Unternehmen investieren in Strategie, in Strukturen, in Prozesse – aber was ist mit der inneren Haltung der Menschen, die das alles umsetzen sollen? Wer Innovation will, muss Menschen befähigen, mit Unsicherheit umzugehen. Wer Zusammenarbeit fördern will, braucht Vertrauen. Und Vertrauen entsteht nicht durch Strukturen, sondern durch innere Kompetenzen. Die IDGs sind so auch kein Wellness-Programm für Führungskräfte, sondern eine Grundlage für zukunftsfähige Organisationen.
TZ: Aber ist es nicht tückisch anzunehmen, dass sich Menschen erst entwickeln sollten, bevor sie richtig handeln? In vielen Feldern läuft uns doch die Zeit davon?
KM: Genau. Die Vorstellung, wir müssten uns erst in Klausur begeben, bevor wir loslegen, wäre ein Missverständnis. Innere Entwicklung ist keine Vorstufe zum Tun, sondern geschieht parallel dazu. Es geht darum, während wir handeln, die Fähigkeit zu entwickeln, es klüger, empathischer, nachhaltiger zu tun. Otto Scharmer verweist auf den „Knowing-Doing-Gap“: Häufig wissen wir längst, was zu machen wäre – aber wir gehen es nicht an. Es geht nicht darum weiter zu fragen, „Was müssen wir tun?“, sondern „Warum tun wir es noch nicht?“ - Darauf wollen die IDGs eine Antwort geben.
TZ: Die ausgehenden 10er-Jahre waren geprägt von New Work, Agilität, Achtsamkeit, Diversity und ähnlichem - in gewisser Hinsicht romantischen Vorstellungen. Mit den Krisen scheinen sich Gegentrends zu formieren, die alte Untugenden hervorkramen.
KM: Widerstand zeigt sich immer, sobald sich etwas verändert. Und ja, es gibt eine Gegenbewegung zu dem, was die letzten Jahre an Aufbruch und Neuorientierung gebracht haben.
Aber Geschichte verläuft in Wellen. Wir sehen das nicht als Bedrohung, sondern als Realität, mit der wir umgehen müssen. Was wir durch die IDGs stärken, ist genau diese Fähigkeit:
mit komplexen, widersprüchlichen Realitäten umgehen zu können, ohne in alte Muster zurückzufallen.
TZ: Gibt es denn messbare Erfolge? Zeigt sich irgendwo konkret, dass die Arbeit an innerer Entwicklung einen Unterschied macht?
KM: Ja, absolut. Unternehmen, die sich intensiv mit den IDGs beschäftigen, berichten von besseren Führungskulturen, höherer Innovationskraft, gesteigerter Mitarbeiterzufriedenheit. Great Place to Work hat beispielsweise untersucht, wie sich bestimmte IDG-Skills in erfolgreichen Unternehmen wiederfinden.
Themen wie Vertrauen, Kommunikationskompetenz, Perspektivenvielfalt. Man kann also sehr wohl empirisch nachweisen, dass innere Entwicklung nicht nur ein netter Zusatz ist.
TZ: „We invite joy“ ist eines euer Kernprinzipien. Warum ist der Wert Freude so ein zentraler Aspekt der IDGs?
KM: Weil Freude eine unterschätzte Motivationskraft ist. Wir setzen da einen bewussten Kontrapunkt zu Angst und Enge. Freude öffnet. Eines der schönsten Komplimente, das wir zum IDG Summit (der jährlichen IDG-Konferenz in Stockholm, Anm.) bekommen, ist, dass sich dieser wie eine „Revolution of Hope“ anfühlt.
Und Hoffnung ist ja kein Schönmalen, sondern hat viel damit zu tun, die Dinge so anzusehen und anzuerkennen, wie sie wirklich sind. Dann generieren wir auch die Kapazitäten, die Neues ermöglichen.
TZ: Wenn du zehn Jahre in die Zukunft blicken – wo stehen die IDGs dann?
KM: Im Grunde sind die IDGs dann erfolgreich, wenn es sie nicht mehr braucht. Wenn innere Entwicklung ein selbstverständlicher Bestandteil von dem geworden ist, wie wir unser Leben gestalten, wie wir Bildung verstehen, miteinander umgehen, Kultur gestalten. Wenn wir Unternehmen haben, in denen Fehler machen kein Tabu ist, sondern ein Zeichen von Mut. Wenn Politiker in Interviews über Perspektiven für die nächsten 100 Jahre sprechen. Dann ist das Bewusstsein, das die SDGs fördern wollen, quasi eingesickert.
Vielleicht sind es ein paar mehr als 10 Jahre, die es bis dahin braucht, aber ich bleibe optimistisch.