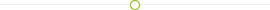Wir haben keine Zeit, erst erleuchtet zu werden
28. Oktober 2025
Die Werte der Generation Z
28. Oktober 2025Ruth Arrich leitet das Wirkungsmanagement bei TGW Future Wings, der sozialen Unternehmung der TGW-Welt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Personalmanagement und als Beraterin setzt sie sich leidenschaftlich dafür ein, dass junge Menschen ihr volles Potenzial entfalten. Seit 2007 initiiert und fördert TGW Future Wings innovative Bildungsprojekte, die Persönlichkeitsentwicklung und Chancengerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen. Die Initiator:innen betonen, Bildung ist ein Grundrecht und bewirkt gesellschaftliche Veränderung.
www.tgw-futurewings.org

Heranwachsende und Werte: Ein Entwicklungsprozess, der Platz finden sollte. Auch - oder gerade in der Berufsausbildung.
Ein Gespräch mit Ruth Arrich.
Vor sieben Jahren sorgte die Eröffnung der Grand Garage für Aufsehen. Den Verantwortlichen, Ruth und Werner Arrich, die zuvor bereits mit CAP.future ein erfolgreiches Bildungsprojekt für Jugendliche etabliert hatten, gelang es, in der Tabakfabrik Linz einen international beachteten Makerspace auf die Beine zu stellen. Zwischenzeitlich kamen weitere Projekte hinzu – so etwa 2024 das INNERversum, das auf Basis der Inner Development Goals junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleitet. Möglich wurden all diese Vorhaben durch TGW Future Wings, das gemeinnützige Engagement des oberösterreichischen Industriebetriebs TGW.
Die Auseinandersetzung mit Werten spielt in der Arbeit mit der nachkommenden Generation eine zentrale Rolle. Wo Jugendliche sich selbst und ihre Zukunftswege erkunden, entstehen Spannungsfelder zwischen tradierten Wertvorstellungen der Älteren, gesellschaftlichem Wandel und den eigenen, oft noch unklaren Überzeugungen. Das ist nicht neu. Doch während Schulen lange Zeit versuchten, die Jugend „geradezubiegen“ und „gesellschaftstauglich“ zu machen, können solche Konflikte auch als Chance verstanden werden – als vitaler Ausdruck einer dynamischen gesellschaftlichen Entwicklung.
Wie können Werte in der Berufsbildung verankert werden? Welche Herausforderungen ergeben sich für Jugendliche, aber auch für Unternehmen und Bildungseinrichtungen? Und wie kann eine werteorientierte Bildungsarbeit aussehen, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern echte Orientierung bietet?
Wir haben Ruth Arrich zu einem Gespräch getroffen. Sie ist für das Wirkungsmanagement der Initiativen
verantwortlich.
Thema Zukunft (TZ): Ihr arbeitet mit Jugendlichen in verschiedenen Kontexten der Berufsbildung. Welche Werte sind in der beruflichen Orientierung heute besonders wichtig?
Ruth Arrich (RA): Jugendliche brauchen innere Stärke, um mit den Herausforderungen unserer Zeit umzugehen, mit all den Tsunamis, mit denen sie konfrontiert werden. Ich habe den Eindruck, viele fühlen sich orientierungslos, überfordert, manchmal auch ohnmächtig. – „Was kann ich schon tun? Am besten gar nichts.“ – Das nimmt zu.
Reflexionsfähigkeit ist da zentral, auch die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln. Sich selbst und das Gegenüber zu hinterfragen, Beziehungen zu betrachten – und so nach und nach die eigene Wertebasis zu erkennen.
Diese gibt dann Halt inmitten all dieser Unsicherheiten.
TZ: Wie können Jugendliche ihre Werte erkennen und für sich nutzen?
RA: Werte sind ja nichts Angeborenes. Sie entwickeln sich durch Sozialisation. Jugendliche kommen mit einer
bestimmten Prägung, ohne diese reflektiert zu haben. Ihnen bewusst zu machen, dass sie eine Wahl haben, welche Werte sie als tragend erachten, ist ein erster, wichtiger Schritt.
„Für welche Werte entscheide ich mich auf meinem Weg?“
TZ: Das ist ja mitunter konfliktträchtig. Und war es wohl immer schon. Die von den Eltern mitgenommenen Überzeugungen erodieren, gleichzeitig sind eigene nicht wirklich stabil, oder?
RA: Das ist definitiv ein Thema. Ich merke, dass Jugendliche da oft innerlich zerrissen sind. Die Einflüsse, die auf sie einwirken, sind vielfältiger als früher – nicht nur soziale Hintergründe, wie vor 30 oder 40 Jahren, sondern auch kulturelle Erfahrungen, unterschiedliche Weltanschauungen und religiöse Positionen. Die Unterschiede zwischen den Jugendlichen sind größer geworden.
Deshalb versuchen wir in unserer Arbeit, angstfreie Räume zu schaffen, in denen solche Fragen offen angesprochen werden können – ohne dass sich jemand sofort verteidigen muss. Es braucht diesen geschützten
Rahmen, damit sie Mut finden,Vertrautes zu hinterfragen und Neues kennenzulernen.
TZ: Es gibt ja den Begriff „Generation Z“ und mit ihm zahlreiche Zuschreibungen, die dem tradierten Werteverständnis der Wirtschaft widersprechen. Stichwort: „Leistungsgesellschaft“. Wie erlebst du diese Altersgruppe im Kontext „Arbeit“?
RA: Ich bezweifle, dass es eine einheitliche „Generation Z“ gibt, die sich durch bestimmte Merkmale auszeichnet. Ich kenne die Trendstudien, aber im Alltag erlebe ich Jugendliche sehr, sehr unterschiedlich. Die einen extrem leistungsorientiert, die an ihren hohen Ansprüchen fast zerbrechen. Die anderen, die sich gegen ein klassisches Leistungsdenken entscheiden. Was zunehmend verschwindet, ist der Mittelbau, die Durchschnittlichen. Früher stellten sie die Mehrheit, heute gewinnen die Ränder. Manche Jugendliche sind extrem überbehütet, wodurch ihnen selbstermächtigende Erfahrungen fehlen und damit die für Berufsleben erforderliche Selbstständigkeit, während andere – gerade, was Bildung betrifft – stark unterversorgt sind. Diese Polarisierung wird zunehmend auch in Unternehmen spürbar.
TZ: Und die Sozialen Medien spiegeln und verstärken diese Entwicklung, oder?
RA: Ja, absolut. Das ist eine Riesenherausforderung, zumal wir Erwachsene meist gar nicht wissen, was Jugendliche dort konsumieren. Eltern merken dies häufig erst, wenn die Sache bereits in eine problematische Richtung läuft. Und Soziale Medien sind leider sehr gut darin, unrealistische Vorstellungen auszuformen.
TZ: Welchen Fokus setzt ihr bei der Integration von Wertearbeit in eure Bildungsprogramme?
RA: Wir schauen uns sehr genau an, wer in unseren Programmen als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dabei ist, und bieten hier spezielle Trainingsreihen an. In unserer Arbeit geht es stark um Haltung, wie man mit
bestimmten Situationen umgeht.
Vorbild sein spielt eine zentrale Rolle. Jugendliche beobachten sehr genau, was Erwachsene tun.
Außerdem setzen wir jede Aktivität in einen ganzheitlichen Rahmen. Gerade bei neuen Technologien, die bei uns ja allgegenwärtig sind, ist es wichtig, sie nicht nur als Werkzeuge zu sehen, sondern auch ihren weiteren Impact zu berücksichtigen. Künstliche Intelligenz wird in Zukunft eine große Rolle spielen – da müssen wir sicherstellen, dass ethische Fragestellungen nicht auf der Strecke bleiben. Themen wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind für uns essenziell. All diese Aspekte und mögliche Auswirkungen erarbeiten wir gemeinsam mit den Jugendlichen.
Und ich finde es auch total wichtig, dass Jugendliche lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Scheitern muss nicht gleich eine Niederlage sein – im Gegenteil: Im Idealfall ist es eine Chance,
sich weiterzuentwickeln. Aber dafür braucht es eine Umgebung, die das
konstruktiv einordnet. Und genau so eine möchten wir auch sein.
TZ: Stichwort Unternehmer:innengeist: Ist das heute noch ein Thema für Jugendliche?
RA: Ja, und was ich merke: Wenn Jugendliche sehen, dass jemand in ihrem Umfeld etwas Eigenes aufbaut, dann inspiriert das enorm. Die Grand Garage ist ja selbst aus einer Idee von jungen Menschen entstanden – und gemeinsam haben wir sie geschaffen. Hier sind wir wieder bei der Vorbildwirkung. Wenn man nah erlebt, dass etwas möglich ist, denkt man viel eher: „Warum nicht ich auch?“
TZ: Spielt dabei die Hoffnung, die Welt mit der eigenen Idee eine Spur besser zu machen, eine Rolle?
RA: Der Wunsch ist auf jeden Fall da. Viele junge Menschen wollen nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch einen sinnvollen Beitrag leisten.
Vermutlich ist es eine Mischung:
„Ja, ich will etwas Bemerkenswertes schaffen, aber ich möchte auch Positives bewirken.“ Möglicherweise ist das eine schöne Abgrenzung zu früheren Generationen, die vielfach den Erfolg um jeden Preis wollten.