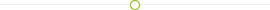Die Werte der Generation Z
28. Oktober 2025
Utopien sind Werkzeuge, keine Ziele
28. Oktober 2025Marc Mertens lebt und arbeitet in Altmünster.
Als Gründer von „A Hundred Years“ hat er Organisationen
wie Mattel, TED oder die Rockefeller Foundation
bei einem werteorientierten Wandel begleitet.
Er bringt seine Kunden jetzt zu mehrtägigen Workshops
der “100 Years School” tief in die Natur des Salzkammerguts,
um dort eine neue Klarheit um die langfristige
Zukunft ihrer Organisationen zu finden.
www.ahundredyears.com

Zwischen amerikanischem
Drive und europäischer Verantwortung.
Der gebürtige Laakirchner Marc Mertens lebte über zwanzig Jahre in Los Angeles, wo er eine Purpose-Agentur aufbaute, mit der er internationale Marken begleitete. Heute ist er mit neuen Plänen retour in
Österreich und denkt weiter in Generationen. Im Dialog mit ihm geht es um Werte, Verantwortung und Unternehmertum und um die Frage, was europäische und amerikanische Modelle voneinander lernen können: Wer denkt nachhaltiger? Wer handelt mutiger?
Thema Zukunft (TZ): Marc, du hast über 20 Jahre in Los Angeles gelebt, die Agentur „A Hundred Years“ aufgebaut und bist dann nach Österreich zurückgekehrt. Deine Agentur basiert auf dem Gedanken, in 100-Jahres-Zeitspannen zu denken. Was hat dich auf diese Idee gebracht?
Marc Mertens (MM): Das kam nicht von heute auf morgen. Der erste Moment, in dem ich angefangen habe, darüber nachzudenken, war in meinen 20ern in L.A. Ich hatte schon damals eine Agentur, es lief gut, aber irgendwann kam die Frage auf: Worauf will ich eigentlich stolz sein?
Ich habe dann „The 7 Habits of Highly Effective People“ von Stephen Covey gelesen. Darin gibt es diese Idee: Stell dir vor, du bist auf deiner eigenen Beerdigung und hörst, was Leute über dich sagen – Familie, Kollegen, die
Gemeinschaft. Und dann frag dich: Was ist dir wirklich wichtig?
Das war so ein Moment der Erkenntnis, weil ich gemerkt habe, dass das, woran ich täglich gearbeitet habe - Wachstum, neue Kunden, Referenzen auf der Webseite – nichts damit zu tun hatte, was mir wirklich etwas bedeutete. Und dann habe ich angefangen, mich mit langfristigem Denken zu beschäftigen.
TZ: Es gibt ja das Konzept der „Enkeltauglichkeit“, also die Idee, dass unternehmerische Entscheidungen auch für die nächsten Generationen Bestand haben sollten. Hat das eine Rolle gespielt?
MM: Total. Die 100 Jahre sind für mich auch deshalb spannend, weil sie noch greifbar sind. 50 Jahre zurück kann man sich ja noch ein Stück weit vorstellen, weil es Fotos gibt, Erinnerungen, Geschichten. Und 50 Jahre nach vorne – meine Tochter in meinem Alter zum Beispiel – das ist auch noch greifbar.
Es ist genau diese Spanne, in der man die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft herstellen kann. Und das ist wichtig, weil wir uns oft nur auf den nächsten Schritt konzentrieren, aber nicht darauf, wohin uns dieser eigentlich bringt.
TZ: Du hast in den USA und Europa gearbeitet. Wo siehst du die größten Unterschiede in der Art, wie Unternehmen geführt werden und welche Werte sie haben?
MM: In Europa gibt es mehr soziale Verantwortung, vor allem in familiengeführten Unternehmen. Da gibt es eher die Haltung: Vielleicht nehme ich mir nicht die größte Gewinnausschüttung raus, sondern behalte
meine Mitarbeiter:innen in der Krise, weil ich langfristig denke. In den USA habe ich das anders erlebt. Dort gibt es dieses stark verankerte Prinzip der individuellen Leistung – der „American Dream“, der sagt: Ich baue mir etwas auf, gegen alle Widerstände. Dies kann eine enorme Energie freisetzen, führt aber auch dazu, dass kurzfristige Gewinne über nachhaltige Entscheidungen gestellt werden.
TZ: Würdest du sagen, dass europäische Unternehmen kulturell resilienter sind?
MM: Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. In Europa nehme ich grundsätzlich eine höhere Akzeptanz für langfristiges, „enkeltaugliches“ Denken wahr. Letztlich aber ist das vor allem eine Frage der Eigentümerstruktur. Börsennotierte Unternehmen stehen – egal ob in Europa oder den USA – unter dem gleichen Druck des Kapitalmarkts, kurzfristige Ergebnisse zu liefern. Familienunternehmen haben hier deutlich mehr Gestaltungsspielraum. Und selbst im Land des Individualismus gibt es Beispiele wie „Patagonia“, die eindrucksvoll zeigen, dass unternehmerischer Erfolg und langfristige Verantwortung kein Widerspruch sein müssen. Ich glaube, in unübersichtlichen Zeiten wie heute ist eine Form von Führung wichtig, die nicht bedeutet: Ich habe alle Antworten. Sondern eher: Ich halte die Vision, aber ich schaffe auch den Raum, in dem gemeinsam Lösungen gefunden werden.
TZ: Hast du den Eindruck, dass jemand wie Elon Musk so führt?
MM: Nein, sein Führungsstil ist für mich kein Beispiel für das 21. Jahrhundert. Kurzfristig kann so etwas funktionieren. Aber langfristig führt es dazu, dass blinde Flecken entstehen. Dreht sich alles um eine Person, traut sich schnell niemand mehr, dieser gegenüber Nein zu sagen. Und ohne Hinterfragen sind Fehlentscheidungen vorprogrammiert.
TZ: Patriarchale Kulturen sind ja vor allem in Familienunternehmen noch präsent, oder?
MM: Absolut. Aber das finde ich spannend: Für ein Familienunternehmen ist die Generationenfrage omnipräsent und damit auch langfristiges Denken. Es ist nicht zukunftsfähig, wenn ich als CEO oder Unternehmer immer allein die Richtung vorgebe. Ich muss Umfelder schaffen, in denen trotz Widersprüchen gute gemeinsame Entscheidungen möglich sind. Das ist besonders wichtig in Situationen, in denen ein Generationenwechsel ansteht. Dabei gestalten wir gerne Räume, die sowohl Platz für die Erfahrung und Weisheit der älteren Generation als auch für die neuen Ideen, Werte und Haltungen der Jüngeren bieten.
TZ: Was sollten sich die Europäer in den Vereinigten Staaten abschauen?
MM: In den USA gibt es eine unglaubliche Risikobereitschaft. Menschen stecken zig Lebensjahre und Millionen von Dollar in eine Idee, nur weil sie daran glauben. In Europa wählt man schnell den vermeintlich sicheren Weg, setzt auf staatlich geförderte Innovationen - und geht Wagnisse nicht als Person ein. Ideal wäre wohl eine Kultur, die Mut mit langfristigem Denken verbindet. Unternehmertum, das sagt: Wir trauen uns etwas, denken es aber langfristig.
TZ: Wenn du auf die nächsten 100 Jahre blickst: Was wäre das Wichtigste, das sich in punkto Leadership
ändern sollte?
MM: Ich glaube, wir müssen lernen, uns mit Ungewissheit wohler zu fühlen.
Die Welt wird nicht einfacher, Krisen sind vorprogrammiert. Es wird helfen, auf Basis echter Werte zu führen, die nicht bloß PR-Strategie sind. Wer langfristig denkt, sich aber trotzdem im Hier und Heute bewegt, wer Unsicherheit aushält, kooperativ Entscheidungen trifft, der muss auch keine Angst vor der Zukunft haben.